Vor etwas mehr als einem Jahr wurde ich ungewollt nicht nur Zeuge sondern Beteiligter eines Streits zweier Freunde. Grund war mein ausgewiesener Hang zur britischen Popmusik, und das Ganze wurde ausgelöst durch die Äußerung von Freund C., für ihn seien „Weezer auch Britpop“, womit er sich von meiner Wenigkeit und seitens meiner belgischen Lieblingsmanagerin (BLM) eine brüske Abfuhr einhandelte. Daraufhin entwickelte sich zwischen C. und BLM das besagte unschöne Streitgespräch, man ging im Unfrieden auseinander, und der eigentlich tolle Abend war im Arsch.
Damals versprach ich beiden, demnächst mal eine klare Definition zu Papier zu bringen, auf dass ein solcher Streit niemals wieder aufkomme, und das Thema ein für alle Mal aus der Welt sei.
Nun, manche Sachen brauchen ihre Zeit, aber es ist ja auch nicht ganz einfach, und lässt sich schlecht in vier Sätzen abhandeln.
Heute aber ist der Zeitpunkt gekommen. Zwei Katalysatoren haben mir geholfen, meine verständliche Abneigung gegen derlei Sysiphusarbeit zu überwinden.
Zum einen lege ich ja inzwischen selbst wieder auf, so dass ich immer häufiger mit der Frage konfrontiert werde, was das eigentlich sei, „Britpop“.
Und zum anderen gelangte ich in den Besitz des MOJO-Sonderheftchens zum Thema, und habe nun also auch endlich eine ausführliche Quellengrundlage für Zitate u.ä.
Also: Was ist Britpop?
Es gibt natürlich eine sehr weite Definition, wie sie im Allgemeinen auch von allen Britpop-DJs gebraucht wird. Nach dieser fällt im Grunde jegliche britische Pop- und Rockmusik unter den Begriff, die irgendwie mit Gitarren erzeugt wird. Lesen Sie z.B. einfach mal meine Playlist, wie ich sie auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt „DJ“ hinterlegt habe.
An einem gewöhnlichen Britpop-Discoabend werden Sie also (sowohl in Großbritannien als auch hierzulande) Musik hören, die einen weiten Bogen spannt, welcher von den Beatles ausgehend, über The Jam, The Smiths, Manchester-Rave, Blur/Oasis, bis zu den jungen Wilden von neulich (Arctic Monkeys, Bloc Party, Kaiser Chiefs etc.) reicht.
Doch schon diese weit gefasste Definition hat ihre Tücken. Sie kennt nämlich durchaus Grenzen aber auch Grenzüberschreitungen. So muss es eben gar nicht immer Gitarrenmusik sein. Etwa Blue Monday von New Order gehört mit Sicherheit zu den Klassikern des Britpop-Kanons. Aphex Twin hingegen mit ebensolcher Sicherheit nicht. Oder nehmen Sie The Who und Led Zeppelin. Beides klassische englische Rockbands. Aber The Who gehören ganz klar dazu, Led Zeppelin ganz klar nicht. Warum?
Nun, offenbar gehört zu der Frage, ob etwas Britpop ist oder nicht, die Frage nach der kulturellen Konnotation des Ganzen mit etwas, was man vermutlich mit dem Begriff „mod-culture“ noch am treffendsten umschreiben könnte. Letztlich hat es also, wie so oft, etwas mit der Frage cool oder uncool zu tun, mit Mode, mit kulturellen Codes, kurz: mit attitude.
So weit, so schwierig.
Weitaus enger gefasst ist jedoch die zweite Definition, und diese dürfte für Puristen die einzig gültige sein, weil sie sozusagen historisch richtig ist. Der Begriff „Britpop“ entstand nämlich erst Mitte der neunziger Jahre als Bezeichnung für eine popkulturelle Massenhysterie genuin englischer Prägung und ihre Hauptdarsteller heißen Blur und Oasis, wobei letztere eher als Nutznießer denn als Begründer zu sehen sind, und vermutlich auch zu einem großen Teil für das schnelle Ende des Phänomens verantwortlich zu machen wären. Und wenn wir diese Geschichte lesen, wird sich uns auch einiges über den Gehalt jener oben erwähnten attitude erschließen, die vermeintlich in diesem Kontext eine so große Rolle spielt.
Was war passiert?
Nun, seit Anfang der Achtziger Jahre wurden in Großbritannien auch die amerikanischen Charts publiziert, und so wurde eben auch der englische Musikmarkt (als letzter in Westeuropa) nach und nach mit amerikanischer Musik infiltriert. So weit erstmal kein Problem. Da die prägenden Subkulturen und Trends der Popmusik weiterhin von der Insel kamen, änderte sich zunächst nicht viel. Bis Anfang der neunziger Jahre das Königreich plötzlich in eine merkwürdige kreative Flaute schipperte. Manchester-Rave war spätestens 1991 an der selbstkreierten Acid-Frenzy implodiert und danach begann im U.K. wie auch hierzulande der große Siegeszug des Grunge.
Es reicht, sich Nirvana anzuschauen, um die weitere Entwicklung zu verstehen: Ein fragiler, von Selbstzweifeln zerfressener junger Mann, der sich selbst offenbar sehr wichtig nimmt, seine Emotionen und seinen Schmerz so direkt und unverblümt in die Welt hinaus schreit, dass es eine Art ist, dazu schlampige Klamotten trägt und am Ende auch noch Selbstmord begeht.
This was absurdly and disgustingly PATHETIC,
m.a.W. dermaßen unbritisch, dass es die Abscheu der urbanen und gebildeten englischen middle-classes geradezu heraufbeschwor, und die kulturelle Gegenbewegung wirklich nur eine Frage der Zeit sein konnte.
Für nicht so in die britische Volksseele Involvierte zitiere ich hier einen kurzen Ausschnitt aus Dietrich Schwanitz‘ Buch Bildung:
„In England ist der Adel mit Teilen des Bürgertums verschmolzen. Das hat die sogenannte „Gentleman-Kultur“ hervorgebracht. Deshalb sind die Verhaltensstandards aristokratisch. Dazu gehört: absolute Selbstbeherrschung. Das produziert jenen oft beschriebenen Eindruck der Kühle und der Unbeeindruckbarkeit, eine Haltung, die man als „steife Oberlippe“ bezeichnet. Als besonders deplaziert gelten übertriebene Gefühlsausbrüche und jegliche emotionale Überflutung der Situation. Einzige Ausnahme: Frauen, Künstler und Schwule dürfen Gefühle zeigen, wenn sie durch theatralische Inszenierung signalisieren, dass sie entweder falsch sind oder dass sie sie im Griff haben (Unterklassenangehörige dürfen sowieso Gefühle zeigen, aber deswegen gehören sie auch zur Unterklasse. Weil sich Lady Diana darüber hinwegsetzte, wurde sie bei den Unterklassen so populär)“
Neben Grunge beherrschten natürlich noch zwei weltweite Konsensplatten die Charts, die ebenfalls beide an unbritishness fast nicht mehr zu überbieten waren: Metallicas schwarzes Album und Blood Sugar Sex Magik von den Red Hot Chili Peppers.
Britpop war Londons Antwort auf Grunge. Tatsächlich haben wir es nämlich hier mal mit einer britischen Subkultur zu tun, die fast ausschließlich in der Hauptstadt ihren Nukleus und ihre Szene hatte (wenngleich Pulp aus Sheffield und Oasis aus Manchester kamen, aber soweit sind wir ja noch nicht).
Das zentrale Album ist Blurs Parklife, ein bewusstes und dezidiertes Anti-Grunge-Album, in dem sich Damon Albarn als krassest möglichen humanen Gegenentwurf zu Kurt Cobain inszenierte. Dazu mussten Blur sich sozusagen selbst neu erfinden, aber das Volk glaubte ihnen gern und begierig, denn es hatte heißhungrig auf ein solches Statement gewartet. Auf Parklife wurde Britishness in all ihren Nuancen und Klischees dermaßen zelebriert, dass es heutzutage beinahe wie Satire wirkt.
Das entscheidende kulturelle Ausrufezeichen wurde aber schon ein wenig früher gesetzt. 1992 erschien die Zeitschrift Select mit folgendem, bahnbrechenden Cover: Suede-Sänger Brett Anderson wurde vor einen Union Jack drapiert, ergänzt um die eindeutige Aufforderung
„Yanks go home!“
Das war die Geburtsstunde von Britpop.
Die Message war eindeutig und sie war nationalistisch.
Und Großbritannien dürstete, wie so oft, danach, sich endlich mal wieder selbst feiern zu dürfen. Schließlich hatte man nicht nur die Demokratie und die Eisenbahn erfunden, sondern auch alle brauchbaren Spielarten der Popkultur, welche, und auch das darf man eben nie außer Augen lassen, im Vereinigten Königreich genau deshalb eine ungleich größere gesellschaftliche Rolle spielt als anderswo.
Wenn Sie denken, ich würde in meiner Analyse übertreiben, dann halten Sie sich bitte vor Augen, dass seinerzeit Damon Albarn und seine damalige Freundin Justine Frischmann (Sängerin von Elastica) tatsächlich und ernsthaft ein „Britpop-Manifest“ ganz im Sinne von Marx und Engels als Anti-Grunge-Hetzschrift verfassten, und lassen sie auch die folgenden beiden Zitate auf sich wirken:
„… it occured to us that Nirvana were out there, and people were very interested in American music, and there should be some kind of manifesto for the return of Britishness. We didn’t think Nirvana said anything to us about our lives. I wasn’t remotely interested. That’s where the manifesto came from.“ (Justine Frischmann)
Und, noch viel deutlicher, Stuart Maconie, der Mann, der für das erwähnte Select-Cover verantwortlich zeichnete:
„Nowadays when, frome Grime to Girls Aloud, from Dubstep to Nu-Prog, British Pop is so fecund and plural, it is hard to dredge up the memory just how grim the early to mid-90s were. I had just quit NME in protest (…) out of boredom with putting out a weekly paper that had nailed its colours to the Grunge mast. I hated Grunge – the terrible clothes and haircuts, the whinig lyrics, the lumpen riffing. The last straw came for me, when we put a band called Superchunk on the cover. They looked like people doing community service who had come to clear up a canal towpath – except less sexy.“
There we are. Als Parklife draußen war, war die Sache im Grunde gelaufen. Britain war zurück auf der Agenda, und alles weitere lief wie von alleine. Und nach musikgeschäftsüblichen Standards und Klischees. Ähnlich wie in Hagen zur Hochzeit der Neuen Deutschen Welle („und montags spielt Dein Tankwart Dir seine neue Maxisingle vor“ – Extrabreit), hatte bald jeder Stammgast der beiden einschlägigen Szenepubs in Camden seinen eigenen Plattenvertrag, oder zumindest eine Band, und in allen anderen Städten sprang man hoffnungsfroh und tatendurstig auf den fahrenden Zug. Pulp wurden plötzlich Popstars, obwohl sich vorher über zehn Jahre lang niemand für sie interessiert hatte.
Einzig: es war bis dahin noch hauptsächlich eine Londoner Subkultur für die upper– und middle-classes. Der Pöbel tanzte weiterhin zu Euro-Techno-Beats.
Enter Oasis.
Klar, die Gallagher-Brüder waren laut und angeberisch, aber das war der Grundtenor der ganzen Bewegung; klar, Noel spielte eine Union-Jack-Gitarre, aber die Flagge war längst wieder zum omnipräsenten tag und Ausweis der Szenezugehörigkeit mutiert (jeder machte ja jetzt Britpop); klar, ihr erstes Album chartete von 0 auf 1, aber auch diesen Stunt hatten zumindest Suede und Blur schon vor ihnen aufgeführt.
Oasis jedoch hatten zwei exclusive Attribute einzubringen, die das Britpopfass letztlich zum Überkochen brachten, und aus einer Aufbruchsstimmung ein Massenphänomen machten:
Oasis waren working-class und lad-culture. Und sie hatten die Songs. Eigentlich war What’s The Story Morning Glory ein mit ziemlich heißer Nadel gestricktes Nachfolgealbum mit einer Menge Mittelmaß. Some Might Say wurde ihre erste Nummer-1-Single, und das ist nun wahrlich kein weltbewegender Song. Aber Oasis hätten zu diesem Zeitpunkt vermutlich auch ein Stück verschimmelte Wurst als Single herausbringen können, und es wäre trotzdem Nummer 1 geworden, denn ganz England wartete nur auf das nächste Lebenszeichen dieser Band, auf die sich nun plötzlich alle Hoffnungen fokussierten.
Alles entscheidend war etwas anderes: Auf diesem, wie gesagt, durchaus diskutablen Album befanden sich drei der schönsten Popsongs, die jemals in der Geschichte der Menschheit geschrieben wurden: Wonderwall, Don’t Look Back in Anger und Champagne Supernova.
Niemand weiß bis heute, wovon diese Songs handeln, aber das war egal, denn sie waren so gut, so einfach, so schön und so unglaublich durchtränkt mit allem, was britische Popkultur jemals groß gemacht hatte, dass sie nicht nur ihren verdienten weltweiten Erfolg einheimsten, sondern sich eben auch als Aushängeschilder des neuen Labels „Britpop“ geradezu aufdrängten.
Blur und Oasis waren also nicht Gegenspieler, wie es oft und gerne kolportiert wird, und von den britischen Medien ja auch stilisiert wurde, sondern sie haben sich kongenial ergänzt.
Der Londoner art-school-wittiness von Blur setzten Oasis den working-class-ethos von Manchester-Lads entgegen, und damit war dann das ganze Volk vereint – music for the masses.
Der Rest ist schnell erzählt. Wie jede Massenkultur und jede Revolution fraß sie ihre Kinder resp. sich selbst (Pop will always eat itself). Also zum einen gab es die megalomanen Auswüchse, wie sie jeder derartige Hype durchleben darf (Oasis veranstalten in Knebworth ein Festival für sich alleine, sowohl Herr Albarn als auch Herr Gallagher werden vom ja nicht zufällig ebenfalls das neue „Cool-Britannia“-Feeling anzapfenden, künftigen Premierminister empfangen etc.).
Zum anderen den Ausverkauf durch die Plattenindustrie, also die Tatsache, dass, wie oben angesprochen, bald jeder in Camden und auch sonstwo, der bei drei nicht auf den Bäumen war, seine eigene Britpopplatte veröffentlichen durfte (Gene, Sleeper, Dodgy, Supergrass, Elastica, Echobelly, Shed Seven, Ocean Colour Scene, Mansun, Hurricane No. 1, und das waren nur die Erfolgreicheren).
Mit durchaus aberwitzigen Pointen; so durfte etwa die Band Menswear ein Album machen, obwohl sie überhaupt erst zwei Gigs in ihrem Leben gespielt hatten. Vermutlich deshalb hat ihre einzige nennenswerte Single Daydreamer nur einen Akkord – es blieb halt nicht viel Zeit zum Songsschreiben…
Außerdem machte jetzt, wie erwähnt, jeder Britpop – alle wollten bei der Party mit dabei sein. Sogar Stephen Duffy (Gründungsmitglied von Duran Duran und one-hit-wonder in den 80ern mit Kiss Me – „Kiss me with your mouth. Your love is better than wine. But wine is all I have.“ – remember?) packte seine Klampfe aus, und selbst Ex-Specials-Sänger Terry Hall schwelgte plötzlich im Pomp der Lightning Seeds.
Soweit greifen übrigens auch weiterhin die Parallelen zur Neuen Deutschen Welle.
Allerdings gibt es einen interessanten Unterschied: während normalerweise solche neuen Strömungen durch den Ausverkauf der Plattenindustrie verwässern, weil halt alles und jedes veröffentlicht wird, was nur irgendwie passen könnte, also Sachen unter das Genre gepackt werden, die mit der eigentlichen Idee rein gar nichts mehr zu tun haben (da ist dann also eine Rock’n‘Roll Kapelle aus München namens Spider Murphy Gang plötzlich New Wave), ist Britpop eher an einer ungesunden Verengung der Schablone zu Grunde gegangen. Was ursprünglich sehr bunt und vielfältig anfing (Pulp z.B. hatten anfangs noch Nummern mit House-Beats im Repertoire) wurde auf ein Standard-Rocksong-Muster zurechtgestutzt, dass natürlich schnell langweilig wurde, wenn man nicht ausgerechnet über die begnadete Songwriting-Kompetenz eines Herrn Gallagher verfügte. Und selbst dessen Grenzen wurden deutlich, als das dritte Oasis-Album Be Here Now sich als ein unhörbarer, weil im Kokain-Überschwang und we-are-gonna-sell-millions-anyway-Bewusstsein völlig totproduzierter Schuss in den Ofen herausstellte. Was um so trauriger ist, weil fast jeder Song auf dieser zum Britpop-Abgesang gewordenen CD ja eigentlich trotzdem pures Gold war. Aber im Soundbrei unterging.
Mit anderen Worten: was als vielfältige, farbenfrohe, offene, neue Szene gestartet war, endete in einer ziemlich konservativen, kreativ eingeschränkten Soße, die bald niemand mehr verzehren wollte.
Zum Schluss noch eine Randnotiz: Oben erwähnter Stephen Duffy war damals einer der besagten Stammgäste in den Camdener Pubs, also sozusagen einer der Tankwarte… Und mit London Girls hat er genau darüber einen Song gemacht. Einen Song, in dem das Wort, vermutlich nicht zum ersten Mal, aber zumindest an zentraler Stelle und für die Nachwelt verbrieft, fällt: „Britpop“!
Fazit:
Britpop in der engen Definiton dürfte ich ausführlich erklärt haben.
Britpop in der weiten Definition, wie wir anglophil Geschlagenen sie benutzen, wird wohl ein schwammiger Begriff bleiben.
Aber eins ist trotzdem klar:
Weezer waren nie und werden niemals Britpop sein.
Yanks Go Home!

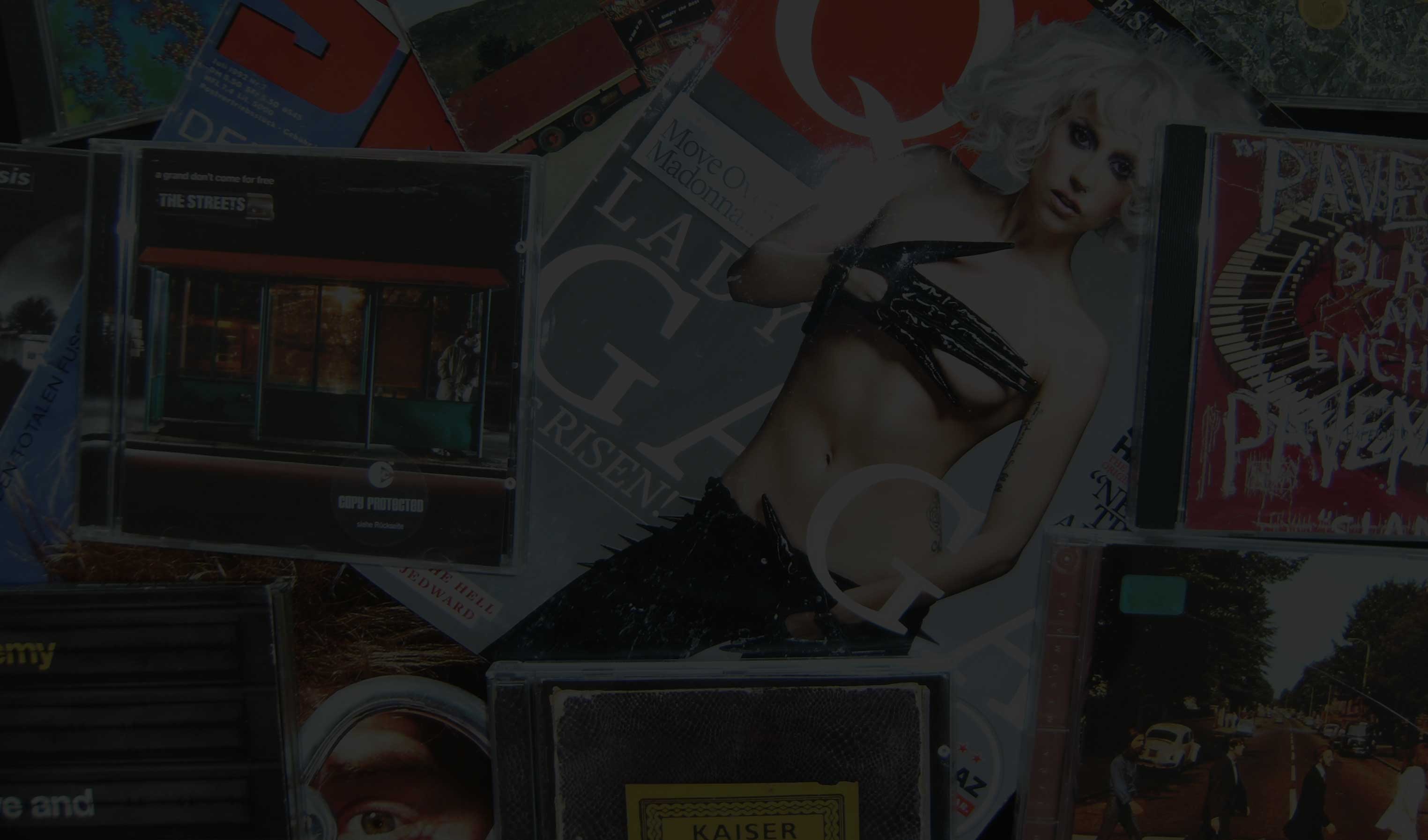
Neueste Kommentare